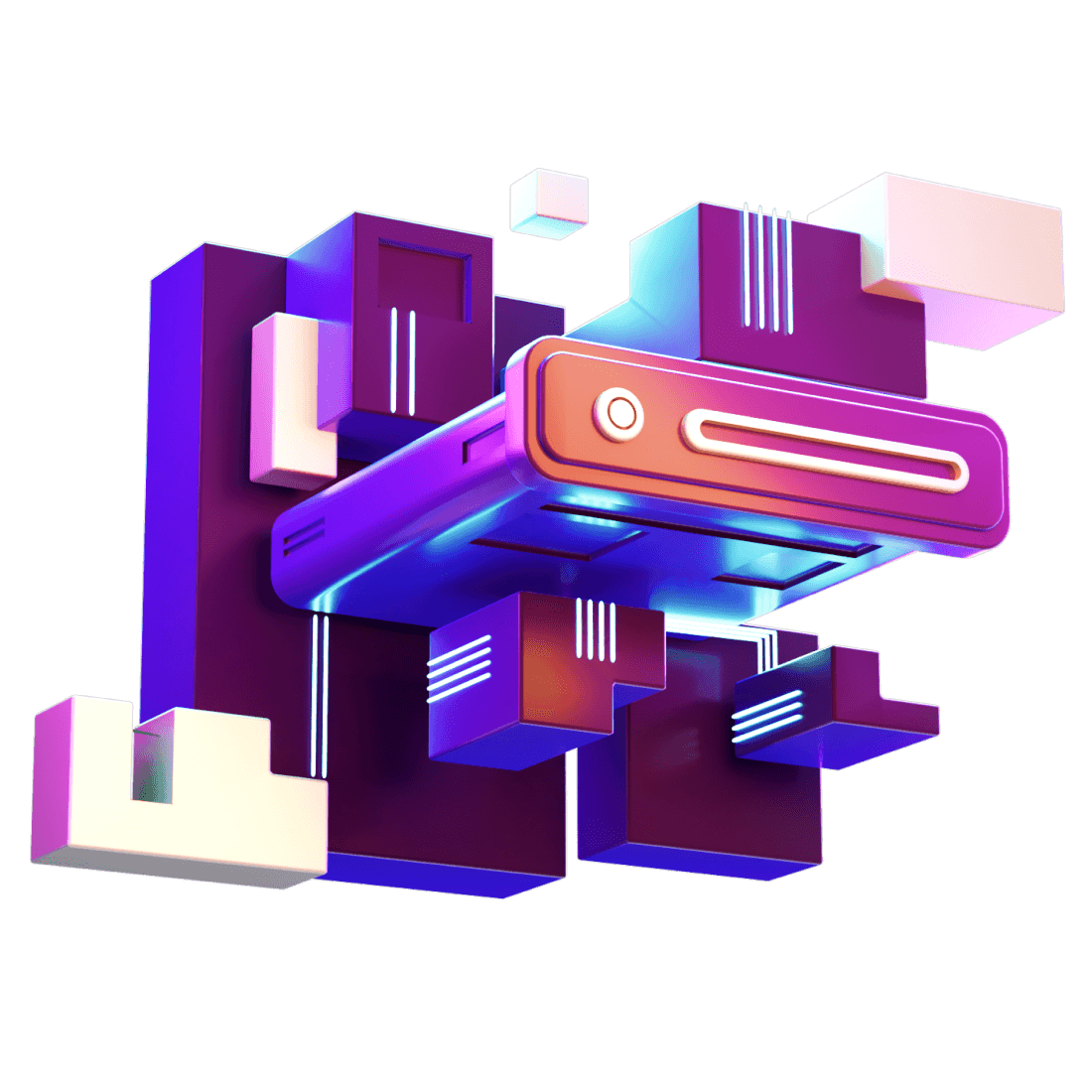
Market's most affordable 6-core dedicated server!
Elastic Metal A610R-NVME and Dedibox START-9-M are now available for €39.99/month.
Discover our offerBuild, train, deploy and scale AI models and intelligent applications on a resilient and sustainable cloud ecosystem.
Create your account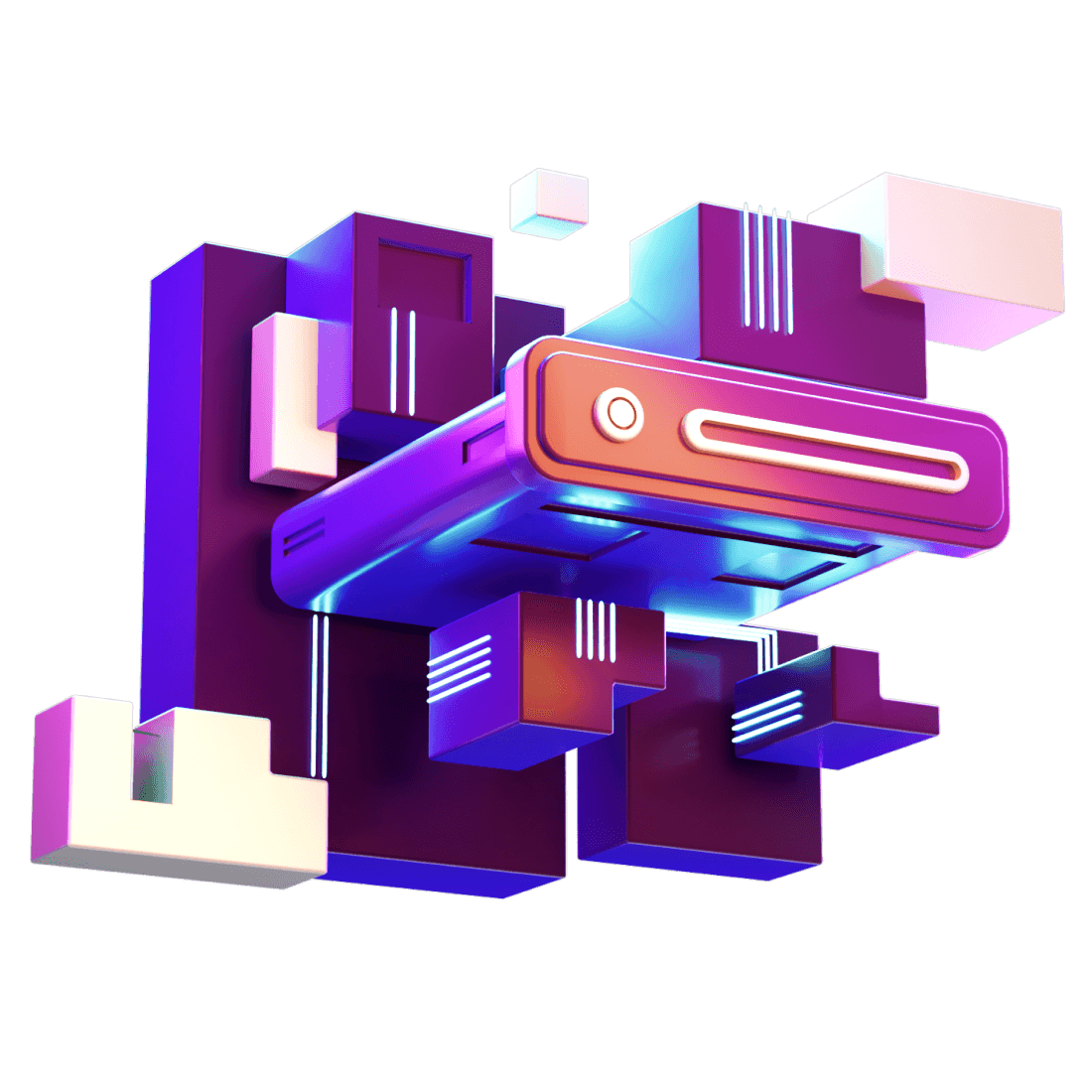
Elastic Metal A610R-NVME and Dedibox START-9-M are now available for €39.99/month.
Discover our offerWe're currently working on Scaleway SuperPod, which is performing exceptionally well.”
Arthur Mensch Co-Founder & CEO, Mistral AI

Scaleway provides a full range of Cloud services to develop innovative solutions and scale AI projects from A to Z. Discover the latest additions to our AI Suite
Discover all our AI solutions
Scale Your Business, Not Your Billing. We offer simple and predictable pricing, with both ingress and egress included in most of our products and no hidden costs.

Ensure Your Security with distributed hosting compliance and certified data centers. Collaborate safely within our ecosystem, thanks to GDPR compliance and robust technical measures for data security.

As a European alternative to hyperscalers, we ensure the data sovereignty of our customers. Create your architecture in a redundant ecosystem, with three availability zones in each of our regions.

Enjoy Your Cloud experience, and get the support you need at each step. We provide 24/7 technical assistance, with fast response and exclusive services from our experts. Rely on a collaborative community to get support from developers.

Discover the power of true hardware isolation and full control over your infrastructure with our bare metal ranges. Choose between our renowned Dedibox range, our cloud-compatible Elastic Metal range, or the Apple Mac mini options.
Get the right instances for every workload, from development to production. Start in seconds at unbeatable prices and scale up to resilient, production-grade computing power.
Enhance the performance and reliability of your infrastructure, including Multi-AZ VPC for high availability, Load Balancer for efficient traffic distribution, and Domains & DNS services for seamless domain management and resolution.
Efficiently manage and scale your data storage and database requirements with Object Storage and Block Storage for flexible data storage, as well as Managed Databases services for simplified database management.
Simplify the development of your applications with Container services to facilitate the management and portability of your infrastructure. From Managed Kubernetes to Serverless Containers, you will have all you need to scale your containerized apps.
A high-performance cloud platform supported by a range of AI services. We provide modern GPU-based infrastructures to enable multi-node training of LLMs and simple node training. We will soon launch a full range of GPU H100 services.

Dependency is the enemy of resilience. Customers want their data hosted by a regional provider. Gain sovereignty with our multi-cloud tools & infrastructure.

We recycle our hardware, only use renewable energy and pay close attention to our water usage. Also, our Power Usage Effectiveness (PUE) is displayed online 24/7 for you to see for yourself.

Every complete cloud ecosystem needs 100% reliability, which is why we provide nine Availability Zones in three different regions.

Get started with peace of mind when you build your infrastructure with the help of technical documentation, step-by-step tutorial, code sample, developer videos and guide.
See our documentationEnjoy the convenience of our API, command line interface (CLI), and developer tools, allowing you to conquer your cloud management goals with unparalleled ease and efficiency.
Discover Scaleway APIStay informed and connected with Scaleway services through our operational Status page, offering real-time updates on the platform, and access our changelog for the latest news and updates regarding our product portfolio.
Check out our changelog